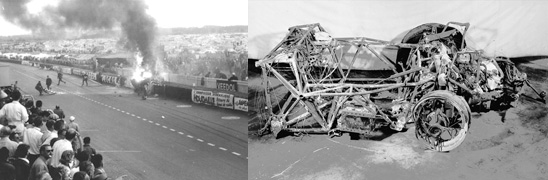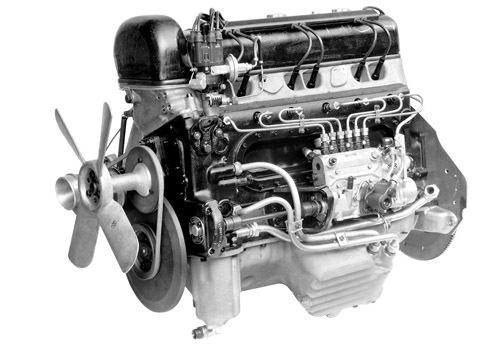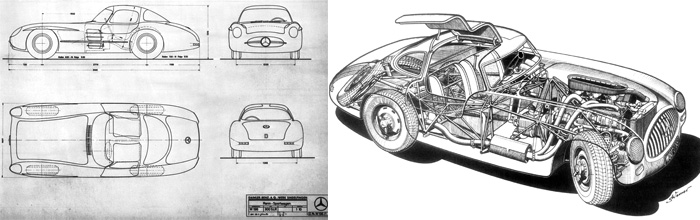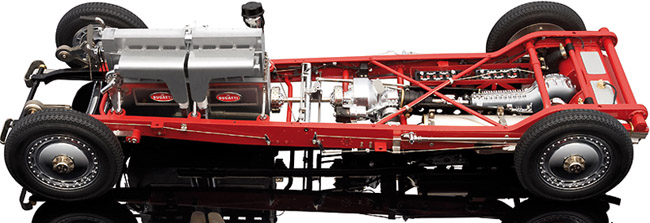Zustandsklassifizierung
Zur Klassifizierung des technischen Zustandes von Oldtimern wird üblicherweise nachfolgendes Notensystem benutzt. Zur Verwendung der Tendenzen (+ oder -) siehe unter „Anmerkungen“.
Der Zustand nach gerade vollendeter fotodokumentierter kompletter Automobilrestaurierung durch einen Fachmann für genau den restaurierten Typ, der hierfür mit hohem Aufwand exzellente Arbeit geleistet haben muss.
(Auf Englisch oftmals „Body Off Restoration“ genannt: die Karosse ist vom Fahrwerk hierzu getrennt gewesen, alle Achsen herausgenommen worden. Letztlich ist jede Verschraubung usw. gelöst gewesen und jedes Einzelteil inspiziert und überholt worden.)
Der Wagen ist wie neu oder sogar besser. Dazu gehören auch „Matching Numbers“, d. h. der Nachweis, dass ein bestimmtes Fahrzeug mit genau dem Motor und dem Getriebe vom Band lief, mit dem er jetzt angeboten wird. Soweit nachvollziehbar gilt dies auch für alle übrigen Teile. Außerdem müssen sowohl die Lackfarbe als auch die Farbe der Innenausstattung der Originalfarbe entsprechen.
„Note Eins“ ist ein äußerst seltener Zustand, gewiss weitaus weniger häufig reell bewertet, als man ihn angepriesen liest. Die Faustformel ist: nur einer von vier angebotenen verdient die „Eins“. Häufiger Fehler falschbehaupteter „Einser“ ist das Hinzufügen von Chrom, wo original keiner war. Einzige Abweichung, die zugelassen ist: das frühere Cadmieren; es wird heute aus Umweltschutzgründen nicht mehr ausgeführt.
Zustand, wie ihn ein komplett restaurierter Wagen nach ca. 3 Jahren pfleglichem Gebrauch hat. Zulässig sind Gebrauchsspuren in Form von ausgebesserten Steinschlägen, Putzspuren im Lack, Spuren an der Pedalerie. Auch den Zustand zwei erreicht man nach einer aufwendigen Restaurierung, wobei an die Ausführungsqualität und die Originaltreue hohe Anforderungen zu stellen sind. Verbesserungen, z. B. ein Getriebe aus einem anderen Modell oder etwa ein anderer Vergaser sind grundsätzlich zulässig, müssen aber unbedingt rückbaubar sein. Auf keinen Fall darf ein „Zustand 2“-Wagen Rost aufweisen, gleich in welchem Umfang oder ob er noch unsichtbar ist.
- Note 3 (gebrauchter Zustand)
Zustand, wie ihn ein total restaurierter Wagen nach ca. 10 Jahren pfleglichem Gebrauch hat. Der augenfälligste Unterschied zur Note 2 besteht in der Tatsache, dass Fahrzeuge im Zustand 3 Rost aufweisen dürfen. Dieser darf jedoch auf keinen Fall an tragenden Teilen sein. Der Motor sollte in Typ und Leistung (nicht im Baujahr) dem Motor des Originalfahrzeugs entsprechen. Ist das nicht der Fall, kann dies als Indiz für einen Zustand 4 gelten, nicht aber als Beweis. Der „Zustand 3“-Wagen ist sofort gebrauchstauglich und verkehrssicher.
- Note 4 (verbrauchter Zustand)
Ein „Zustand 4“-Wagen ist nicht sofort gebrauchstüchtig, aber rollfähig. Der Motor muss drehen. Es müssen alle Teile für eine Restauration vorhanden sein. Für den Wert eines solchen Wagens ist entscheidend, ob sich der Wagen „auf dem Weg der Besserung“ oder auf dem „absteigenden Ast“ befindet. Zur erstgenannten Kategorie gehört ein Fahrzeug, dessen Restaurierung bereits nennenswert begonnen hat. Letzterer Gruppe gehören Fahrzeuge an, die über die Jahre stetig abgenutzt wurden und auf diesem Weg in den Zustand 4 geraten sind.
- Note 5 (restaurierungsbedürftiger Zustand)
Fahrzeuge im Zustand 5 sind mit gerade noch vertretbarem Aufwand restaurierbar. In der Regel werden diese Fahrzeuge als so genannte Teileträger gehandelt (bzw. mit der Angabe „zum Ausschlachten“). Hier hängt der Wert des Wagens maßgeblich von zwei Faktoren ab, nämlich zum einen der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und zum anderen dem Maß der Schäden an der Bodengruppe oder an der Karosserie. Fahrzeuge im Zustand 5 sind mehr wert, wenn die Versorgung mit Teilen noch gut ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Hersteller eine gute Ersatzteileversorgung auch für Oldtimer hat, oder wenn eine Szene aus Liebhabern und Händlern eine funktionierende Ersatzteilversorgung sicherstellt, wie z. B. bei vielen englischen Fahrzeugen. Auf ähnlich hohem Niveau befindet sich allerdings auch die Ersatzteilversorgung durch BMW, Porsche und Mercedes-Benz für ihre alten Modelle. Im Allgemeinen hat dies allerdings dann auch einen der Qualität der Ersatzteilversorgung entsprechenden Preis zur Folge
Der Schrottwert stellt dabei keine Sockel-Linie für den Wert dar, da es oftmals ideelle Gründe gibt, ein Fahrzeug zu erhalten und nicht der (teilweise ökonomischeren) Metallverwertung zuzuführen. Es kann dadurch die paradoxe Situation entstehen, dass ein Produkt durch Aufwenden von Arbeit weniger wert geworden ist.
- Sondernote „Unrestauriertes Original“
Seit einiger Zeit setzt sich die Ansicht immer mehr durch, dass ein Fahrzeug, das über „Patina“ verfügt, und dessen Erscheinung gleichsam von einer anderen Zeit berichtet, einen höheren Wert genießen soll. Ein Wagen, der Zeitzeuge ist und eine Geschichte erzählen kann, wird dann als „unrestauriertes Original“ bezeichnet. Obwohl, schon der Abnutzung wegen, nach den vorgenannten Kriterien allenfalls eine Note von 3 oder 4 in Betracht kommt, erreichen solche Fahrzeuge oft den Wert eines Wagens mit Zustand 2. Dies ist insbesondere bei Fahrzeugen der Fall, die es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht haben, z. B. durch Fernsehauftritte, Rennsiege oder Rekordfahrten.
Diese Frage wird in den Clubs oftmals kontrovers diskutiert, weil sich von einem behauptet wertvollen, unrestaurierten Wagen die Besitzer von Wagen, die aufwendig mit hohen Kosten und viel Zeiteinsatz restauriert wurden, provoziert fühlen: wie könne es sein, dass ein Auto mit schlechter, alt gewordener Lackierung wertvoller sei als ein neu lackierter Wagen? Das Argument ist: Einen neuen Lack kann man beliebig jederzeit kaufen, nicht jedoch den originalen, zeitlich passenden Neulack zum Produktionszeitpunkt: der ist unersetzlich.
Dass diese Ansicht überhaupt aufkommen und sich durchsetzen konnte, dürfte in dem besseren Korrosionsschutz der Hersteller seit etwa den 1980er-Jahren begründet sein: Bei Baujahren etwa seit dieser Zeit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Wagen mit “Patina” noch keine schweren Korrosionsschäden hat und somit sowohl Gebrauchstüchtigkeit als auch Restaurationsfähigkeit leichter gegeben sind.
Anmerkungen
Die Zustandsnoten, die ein Verkäufer angibt, entsprechen in ihrer übergroßen Mehrzahl nicht dem tatsächlichen Zustand. Insbesondere bleibt festzustellen, dass die „Tendenzen“ (z. B. 2 minus) in Zustandsangaben oft eine Erfindung des Verkäufers sind und benutzt werden, um den Ausgangspunkt für Verhandlungen festzulegen, also eine Diskussion, dass ein Fahrzeug im behaupteten Zustand „Zwei minus“ in Wahrheit nur im Zustand drei oder vier ist, gar nicht erst zulassen zu wollen. Innerhalb der Zustandsnoten gibt es dann Preisspannen, die nach oben oder unten ausgenutzt werden können.
Die Note 1 wird in aller Regel nicht offen gehandelt, wenn, dann selten nur unter Insidern und Clubmitgliedern, da die Kosten, die erforderlich sind, um einen Wagen auf Zustand Eins zu halten oder ihn gar wieder in Zustand Eins zu versetzen, extrem hoch sind. Ein Einser-Besitzer wird in aller Regel sein Auto lebenslang nicht mehr hergeben wollen, Erbfälle sind daher der Regelfall für einen Besitzerwechsel.
Obwohl einige Definitionen der Zustandsnote 2 mit denen des bundesdeutschen „H-Kennzeichens“ übereinstimmen, ist die Bewertung keineswegs deckungsgleich. Tatsächlich gibt es mehr Übereinstimmungen mit der Note 3: das frisch erhaltene H-Kennzeichen sichert einigermaßen einen Zustand 3 ab, ist jedoch durchaus kein Nachweis, ein Fahrzeug befinde sich im Zustand 2. Dies wird oftmals zwar der Fall sein, jedoch oftmals auch nicht, weil nicht alle Details original sind. Fehlkäufe angeblicher Zustand-Zwei-Fahrzeuge sind letztlich oft die teuersten Käufe, wenn sich dann herausstellt, dass etliche Merkmale zur Originalität nicht gegeben sind. Daher ist immer eine kundige Begleitung beim Kauf anzuraten, wenn eigene Kompetenz beim Käufer fehlt. Experten sind in den Markenclubs zu finden, oftmals mit höherem speziellen Wissensstand als die mit breiter Basis arbeitenden Kraftfahrzeug-Sachverständigen und Gutachter.
Zustände können sich nur auf ein Fahrzeug im Ganzen beziehen (also nicht „im wesentlichen Zustand 2“ oder „Karosserie Zustand 3“).
Der Wert eines Oldtimers ist von vielen wertbildenden Faktoren abhängig. Die Wiederaufbau-Kosten sind dabei regelmäßig höher als der Markt-Wert. Aus diesem Grund gibt es etwa für „Zustand 1“-Autos keinen signifikanten Markt. Als Faustformel für den Wert eines Oldtimers gilt die „3-zu-1-Regel“, die besagt, dass man für drei Euro, die man in den Wagen investiert, bei einem Verkauf nur einen zurückerhält. Zudem bleibt der Wert der eigenen Arbeitskraft unberücksichtigt.
Inzwischen hat sich, neben der bisher hauptsächlich behandelten Originalitäts-Fraktion der Oldtimerszene, eine meist recht junge und vitale Szene herausgebildet, die Oldtimer als einen Teil ihres Lebensstils betrachten. Herausragend hier sicherlich die Rockabilly- und Hot-Rod-Szene, die mit Sicherheit einen bedeutenden Teil der, wenn auch zumeist US-amerikanischen, Automobilgeschichte und -kultur repräsentiert. Diese Szenen sind aufgrund ihrer subkulturellen Abgrenzung und fehlender Vorschriftswerke eher zugänglich, wenn finanzielle Mittel weniger im Vordergrund der Beschäftigung mit interessanten Fahrzeugen stehen. Hier werden beispielsweise auch Oldtimer, die sich nicht im Originalzustand befinden, gesucht und geschätzt. Meistens ist ein zeitgenössisches Tuning von Fahrzeugen dabei durchaus Ziel von Umbauten und Leistungssteigerungen. Bei der herkömmlichen Bewertung zur Vergabe eines H-Kennzeichens wie auch von Oldtimerversicherungen wird diese wachsende Szene in Deutschland bisher wenig beachtet.